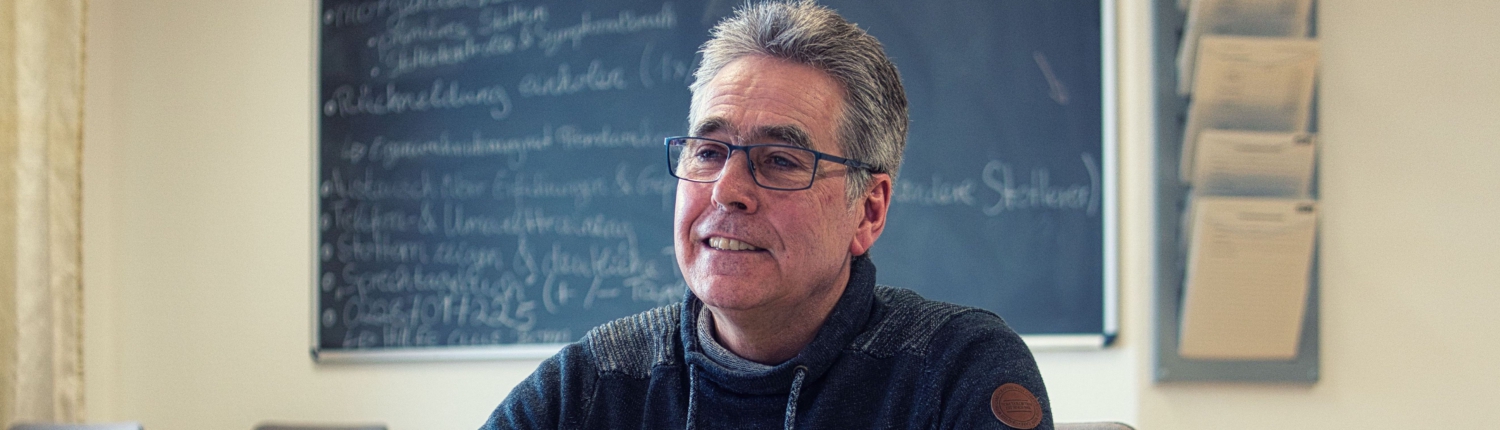Der folgende Erfahrungsbericht ist dem Therapiehandbuch der Bonner Stottertherapie entnommen. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Betroffene sich in zentralen Punkten meiner Auseinandersetzung sehr gut wiederfinden und auch Angehörige durch diesen Beitrag ein tieferes Verständnis für die Stotterproblematik erlangen können. Von daher eignet sich der Text als Therapieeinstieg für Patienten*innen und deren Sozialpartner*innen.
Jeder muss seinen eigenen Weg finden und gehen. Was ich im folgenden niedergeschrieben habe, spiegelt meine eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen wieder. Zwar wird Dein Weg nicht der gleiche sein. Und doch glaube ich, wirst Du Dich in Deiner Auseinandersetzung in verschiedenen Punkten wiederfinden.
Als Kind bin ich – wie viele stotternde Kinder – recht offen und unbekümmert mit meinem Stottern umgegangen. Mit zunehmenden Alter begann ich mich jedoch dafür immer mehr zu schämen. So entwickelte ich verstärkt Strategien, es zu verstecken. Ich ersetzte die stottergefährdeten Wörter durch andere, sprach meist nur, wenn ich merkte, dass es ohne Stottern möglich war und meldete mich in der Schule immer weniger, bis ich schließlich jegliche Äußerung im Unterricht verweigerte. In den wenigen Momenten, wo ich allen Mut zusammennahm bzw. nicht vermeiden konnte, stotterte ich so stark, dass ich am liebsten im Boden versunken wäre.
Niemals hätte ich zu dieser Zeit über mein Problem Stottern gesprochen. Dazu habe ich es viel zu sehr gehasst. Vielmehr versuchte ich, das Problem so weit wie möglich zu verdrängen. Nach außen bemühte ich mich stets, souverän und frei von Problemen zu wirken. Da ich mich bei schnellen, kurzen Äußerungen sprachlich sicher fühlte, war ich bald als „Sprücheklopfer“ bekannt. Aufgrund der vielen Vermeidungstricks wussten viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis gar nichts von dem Ausmaß meiner Stotterproblematik, manche wussten noch nicht einmal, dass ich Stotternder bin. Jahrelang hatte ich das Problem nur vor mir hergeschoben. Ich wünschte mir einfach an einem Morgen aufzuwachen, und das Stottern wäre endlich weg. Doch in meinem Innersten wusste ich, dass ich mich irgendwann dem Problem stellen muss. Drei ambulante Therapien im Kindes- und Jugendalter blieben ohne Erfolg. Es war offensichtlich, dass die Therapeuten*innen das Problem auch nicht ansatzweise verstanden hatten.
Der Ermutigung meiner Eltern habe ich es zu verdanken, dass ich mich im Alter von 19 Jahren zu einer mehrmonatigen stationären Therapie entschloss. Der zuständige Therapeut hatte eine klare Auffassung vom Stottern: Aussagen wie „Stottern ist Körperverletzung“. oder „Stottern ist wie Mundgeruch“ standen in riesigen Buchstaben an der Wand im Therapieraum geschrieben. Somit war das Therapieziel eindeutig: Nicht mehr stottern! Und tatsächlich: Die Therapie half mir, ohne großen persönlichen Einsatz sehr flüssig zu werden. Es war ein wunderbares Gefühl. Ich kam nach Hause und konnte genauso reden wie die anderen. Ich genoss die neugewonnene Sicherheit und die traumhafte Erfahrung, ohne Einschränkungen sprechen zu können. Mein Berufsziel stand fest: Ich studierte Sprachheilpädagogik mit dem Wunsch, Stottertherapeut zu werden. Studienbegleitend behandelte ich in einer ambulanten Sprachheilpraxis schon bald jugendliche und erwachsene Stotternde. In allen Bereichen – ob in meinem neuen Freundeskreis, an der Universität oder gegenüber den stotternden Patienten*innen – stellte ich mich als „ehemaliger Stotternder“ vor, als einer, der es „geschafft“ hatte.
Und doch wusste ich, dass es nicht stimmte. Ich spürte das Stottern weiterhin in mir. Aber ich zeigte es niemals nach außen. Heute weiß ich, dass ich meine Angst und Schamgefühle vor dem Stottern nicht abgebaut hatte. Sie waren nur durch die (vorübergehende) Flüssigkeit überdeckt worden. Meine negative Einstellung gegenüber dem Stottern wurde durch die vorangegangene Therapie zusätzlich verstärkt. Die wirkliche Auseinandersetzung stand mir noch bevor. Und so kam es, wie es kommen musste.
Zuerst waren es nur vereinzelte Wörter, bei denen ich im Vorfeld spürte, stottern zu müssen. Bald wurden es immer mehr. Ich begann alle Sätze nach stottergefährdeten Wörtern abzusuchen, um sie dann blitzschnell durch andere Begriffe zu ersetzen. Für meine Umwelt war ich weiterhin vollkommen flüssig. Niemand ahnte, welches Maß an geistiger, seelischer und körperlicher Anspannung ich erlebte. Durch den zunehmenden Druck, stottern zu müssen, aber es nicht zeigen zu dürfen, befand ich mich in einem Zustand wachsender innerer Alarmbereitschaft. Mich als Stotternder nach außen zu zeigen, war zu diesem Zeitpunkt absolut unvorstellbar. In meiner Welt hatte Stottern keinen Platz. Stottern war für mich Erniedrigung und Niederlage – mit extremen Selbstabwertungen besetzt. Endlich gehörte ich zu den Normalsprechenden, und obwohl ich immer mehr daran zerbrach, wollte ich dieses Image um keinen Preis aufgeben. Die Sprechängste wurden immer größer, und schon bald kreisten meine Gedanken nur noch um das Stottern. Ich empfand mich selbst als einzige Lüge.
Ich vertraute mich meinen Eltern und einzelnen Freunden*innen an – natürlich nichtstotternd. Doch sie verstanden mein Problem nicht. Wie sollten sie auch? Für sie sprach ich stotterfrei. Ich spürte, dass es so nicht weitergehen kann, wusste aber keinen Ausweg. Es wäre an sich so einfach gewesen. Ich hätte nur mein Stottern rauslassen müssen, aber genau das war für mich unmöglich!
Irgendwann fühlte ich mich dem beruflichen Druck nicht mehr gewachsen. So beschloss ich, meine Tätigkeit als Stottertherapeut aufzugeben und eine Umschulung im EDV- Bereich anzustreben. Nur nicht mehr sprechen müssen!
Aber es kam anders: Die LVR-Klinik Bonn bot mir eine Stelle als Stottertherapeut an. Dieses Angebot abzuschlagen, hätte ich mir nie verziehen. Von nun an war ich zuständig für die stationäre Behandlung jugendlicher und erwachsener Stotternder. Die nächsten Jahre verliefen wie die vorangegangenen. Ich fand keinen Ausweg aus meiner Stotterangstproblematik. Doch irgendwann muss sich jeder Mensch entscheiden, ob und welche Konsequenzen er aus einer Krise zieht.
In einer Einzeltherapiestunde mit einer stotternden Patientin war schließlich der Zeitpunkt gekommen, mich meinem Stottern zu stellen. Es wäre ein Leichtes gewesen, das stottergefährdete Wort erneut durch ein anderes zu ersetzen. Aber ich konnte und wollte nicht mehr. Es war eine bewusste Entscheidung. Nach 11 Jahren nahezu stotterfreien bzw. stottervermeidenden Sprechens stotterte ich wieder. Es war ein langer, schwerer, nicht enden wollender Block – weit stärker, als ich je einen zuvor erlebt hatte. Es war eine sehr schwere Erfahrung. Und doch war da ein Gefühl von Erleichterung, verbunden mit der tiefen Gewissheit, den ersten entscheidenden Schritt endlich vollzogen zu haben.
Mein weiterer Weg vollzog sich von nun an in kleinen, aber stetigen Schritten. Ich wagte es immer mehr, mein Stottern herauszulassen, auf privater wie auf beruflicher Ebene. Meine Freunde*innen und Arbeitskollegen*innen reagierten (natürlich) verständnisvoll. Auch im Kontakt mit fremden Personen erlebte ich fast durchgängig positive bzw. neutrale Reaktionen. Die neuen Erfahrungen veränderten meine Einstellung zu mir und meinem Stottern. „Ich darf stottern“ und „Es passiert nichts, wenn ich stottere“ wurden in dieser Zeit zu meinen persönlichen Leitsätzen. Ich begann, mein Stottern zunehmend offener und selbstbewusster zu zeigen und erlebte, wie sich meine Sprechängste immer mehr auflösten. Es war ein sehr befreiendes Gefühl, endlich mit mir und meinem Stottern Frieden zu schließen und ohne inneren Druck sprechen zu können. Ich hatte endlich gelernt, mich als Stotternder grundlegend zu akzeptieren.
Und doch sehnte ich mich zunehmend nach erneuter Kontrolle über das Stottern. Die immer wiederkehrenden Momente starken Kontrollverlusts schufen eine wachsende Unzufriedenheit in mir.
Ich hatte erlebt, dass Stottern in einem hohen Maße veränderbar ist. Warum trat ich meinem Stottern nicht entschieden entgegen? Wo hört positive Akzeptanz auf, wo setzt Bequemlichkeit oder gar Resignation ein? Ich fragte mich, wie viel und welche Art von Stottern für mich in privater und beruflicher Hinsicht akzeptabel sei. Und: Wenn ich mich nach mehr Flüssigkeit und Kontrolle sehnte, warum wurde ich nicht endlich aktiv, zumal mir von meinem Wissen her viele Möglichkeiten offen standen? Eines war klar: Es ging nicht um absolute Flüssigkeit, schon gar nicht zum Preis der alten Vermeidungs- und Angstproblematik. Mein Ziel war klar: Ich wollte ein selbstbewusster und flüssiger Stotternder werden. In der nächsten Zeit experimentierte ich mit den unterschiedlichsten, mir innerhalb der Stotterliteratur bekannten Modifikations- und Fluency-Shaping-Techniken. Doch ich musste schon bald erkennen, dass mein halbherziges Ausprobieren eine wirklich tiefgreifende Veränderung meines Stotterns ausschloss. Wie im Bereich Akzeptanz wurde von mir auch hier eine klare Entscheidung verlangt. So machte ich mich auf den Weg, die Techniken konsequent zu erarbeiten und umzusetzen.
Natürlich blieb meine berufliche Arbeit von meiner eigenen Auseinandersetzung nicht unbeeinflusst. Vielmehr veränderte ich in dieser Zeit grundlegend die Bonner Stottertherapie und entwickelte sie weiter. Im gleichen Rahmen, in dem ich mich selbst mit Inhalten wie Identifikation, vorzeitiger Symptomwahrnehmung, Modifikations- und Fluency-Shaping-Techniken auseinander setzte, fanden diese Punkte auch Eingang in die Konzeption. Schon bald spürte ich, bei welchen Techniken ich ein tiefes Gefühl von Kontrolle und Zuverlässigkeit erfuhr. Es war ein ganz neues, wunderbares Gefühl. Im Rahmen meiner eigenen stationären Therapie hatte ich seinerzeit spontane Flüssigkeit erlangt – ohne genau zu wissen, warum. Doch spontane Flüssigkeit ist wie das Wetter, bei dem nach einem „Hoch“ unweigerlich, ohne dass man Einfluss nehmen kann, das nächste „Tief“ kommt. Wenn man spürt, dass es nach der Phase der spontanen Flüssigkeit sprachlich bergab geht, gibt es nichts, was man dagegen tun kann. Man ist dem Stottern wieder hilflos ausgeliefert.
Kontrollierte Flüssigkeit – das spürte ich sofort – ist etwas völlig anderes. Ein Stotterereignis im Vorfeld zu spüren, aber nicht in das alte Stottermuster und die alte Hilflosigkeit abzugleiten, sondern mit einer kontrollierten Technik dem Stottern den Angriffspunkt zu nehmen, ist wohl für jeden Stotternden immer wieder eine sehr befriedigende Erfahrung.
Mit Hilfe der Techniken „Stotterkontrolle“ und „Fluency Shaping“ sprach ich bald sehr flüssig. Nur noch vereinzelt spürte ich, stottern zu müssen. Diese wenigen Momente konnte ich mit Hilfe der Techniken fast immer kontrollieren, und wenn ich mal unkontrolliert stotterte, war es mir egal. Diese Akzeptanz dem Stottern gegenüber hatte ich mir zum Glück erarbeitet.
Und doch: die Auseinandersetzung ging weiter. Die weiteren Jahre verliefen nicht durchgängig problemlos. Natürlich erlebte ich (leichte) Rückfälle, verfiel zwischenzeitlich in alte Vermeidungsstrategien und erfuhr in bestimmten Situationen erneut stärkeren Kontrollverlust beim Stottern. Aber ich habe mich immer wieder herausgezogen. Ich habe es nie wieder zugelassen, dass mich das Stottern und die Angst kontrollieren. Nun habe ich das Ruder übernommen und bestimme, wohin mein Weg geht. Das Ende des Weges, die von vielen ersehnte Heilung, werde ich nie erreichen. Aber diese Frage stellt sich für mich gar nicht mehr. Wenn ich die Zeit rückblickend betrachte und sehe, welches Maß an Flüssigkeit und Kontrolle ich mir im Sprechen in all den Jahren erarbeitet habe – ohne wie früher zu verleugnen, dass ich Stotternder bin – kann ich mit Zufriedenheit feststellen, dass ich sehr viel erreicht habe.
Stottern hat für mich aufgehört, ein Problem zu sein. Und nur das zählt.
Holger Prüß